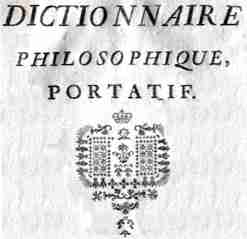Einen Himmel gibt es nicht, es gibt eine ungeheure Anzahl von Weltkugeln, die durch den leeren Raum kreisen.
Trotzdem hat es die unsinnigsten Ansichten über den Himmel gegeben, Voltaire stellt einige davon vor und wundert sich, dass man den Himmel dann auch noch mit Göttern bevölkert hat.
Dass bedeutende Heilige keineswegs auch gute Astronomen sein müssen, beweist Augustinus, der meinte, die Kugelform der Erde bezweifeln zu müssen, weil sonst die unten Lebenden mit den Füssen zuoberst gehen müssten.