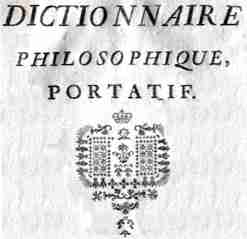Hintergrund:
Das 18. Jahrhundert war, noch kurz vor dem Erscheinen des Philosophischen Wörterbuchs Voltaires, Schauspiel einer heute fast unbekannten, sehr heftig geführten Auseinandersetzung über China. Erbitterte Angriffe gegen Chinas angeblich götzendienerische Religion wurden von christlich-fundamentalistischer Seite geführt und trugen zum Verbot des Jesuitenordens bei, weil dieser sich der geforderten Sinophobie verweigerte. Diese antichinesischen Angriffe legten auch die Wurzeln für den Hass, der China im 19. Jahrhundert während der Zeit der Kolonisierung entgegenschlug und wirken noch heute in der agressiven Ablehnung Chinas fort, weil es dem westlich eingespielten Modell einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie nicht folgt und nicht zu folgen bereit ist.
Bei der Missionierung für das Christentum war in China der Jesuitenorden besonders erfolgreich. Seit Pater Matteo Ricci (1555-1610), Pater Johann Adam Schall von Bell (1591 -1666) und viele andere Jesuiten sich in einer über 100 jährigen zähen Missionsarbeit mit ihren Kenntnissen auf den Gebieten der Geometrie, Astronomie und Mathematik das Vertrauen des chinesischen Hofes erworben hatten, ging es mit dem Christentum in China voran. Selbst Mitglieder der Kaiserfamilie waren Ende des 17. Jahrhunderts zum Christentum übergetreten und der Kaiser Kangxi höchstpersönlich erließ am 22.3.1692 ein Toleranzedikt, dass den Christen (Jesuiten) für ihre Missionstätigkeit freie Hand ließ.
Der Erfolg der Jesuiten war erstens ihren unbestreitbaren wissenschaftlichen Kenntnissen, die sich die Chinesen zunutze machten, zweitens ihrer Anpassungsbereitschaft an lokale chinesische Gepflogenheiten (z.B. der Kleiderordnung) und drittens ihrer Bereitschaft, die religiösen Riten und Gebräuche in das von ihnen den Chinesen verkündete Christentum zu integrieren (Einen kurzweilig zu lesenden Überblick über das Engagement der Jesuiten in China gibt: Fülöp-Miller, Réné, Macht und Geheimnis der Jesuiten, 1947 VMA: Wiesbaden 1960, 829 S., insb. S.350-419).
So war es auch im Falle der Chinamission: Plötzlich erschienen Pamphlete, die die Jesuiten anklagten, die christliche Lehre verwässert zu haben, indem sie den chinesischen Ahnenkult akzeptierten, die Anbetung von Ahnenbildern/-statuen tolerierten, was Götzendienst sei und schließlich, dass sie die Kreuzigung Jesus bei ihrer Verkündigung des Christentums unter den Chinesen unter den Teppich kehrten (was stimmte, denn die Jesuiten wussten sehr wohl, dass der Kreuzestod für Chinesen eine äußerst verächtliche und schmachvolle Todesart war).
Nach Jahren der Mißwirtschaft in Frankreich war die Monarchie geschwächt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts gewann die Kirche wieder stärkeren Einfluß auf den Hof. Sie hatte direkten Kontakt zum König über den am Hof installierten königlichen Beichtvater (einen Jesuiten), der 1670 sogar das Recht erhielt, Kandidaten für sämtliche neu zu besetzenden Kirchenstellen vorzuschlagen. Sie nutzte den Zuwachs an Einfluss sofort, um die ihnen verhassten Hugenotten einer heftigen Verfolgungswelle zu unterziehen. Aber sie überspannten den Bogen und gingen auch gegen die Janseninsten vor, die im absolutistischen Machtapparat sehr viel besser verankert waren. So kam es, dass am Ende der Jesuitenorden selbst als Gefahr für den Absolutismus gesehen wurde und 1764 in Frankreich, aber auch in Portugal und in Spanien verboten wurde. Das war praktisch: man zeigte dem Papsttum seine Grenzen, attackierte „nur“ seinen wichtigsten Orden und ermöglichte so der Kirche, sich durch taktische Manöver aus dem Schussfeld zu nehmen, wobei sie auch nicht davor zurückschreckte, die Jesuiten, denen sie so viel zu verdanken hatte, durch Dominikaner und Franziskaner angreifen zu lassen.
Die Kampagne gegen die Jesuiten gipfelte schließlich in der Aufhebung des Jesuitenordens durch den Vatikan im Jahr 1773 und in allen katholischen Ländern Europas.
Voltaire bezieht sich auf den Bericht des Jesuiten Daniel Louis le Comte (1655 – 1728) (zu le Comte s. frz. Wikipediaartikel , mit einer Beschreibung der von Ludwig XIV. unterstützten jesuitischen Mission) , der seine Erfahrungen als christlicher Missionar in China in dem 1696 erscheinen Werk Nouveau mémoire sur l’état présent de la Chine veröffentlichte und damit großes Aufsehen erregte, vor allem, weil er behauptete, die Chinesen hätten die wahre Religion bereits viele Jahre vor dem Christentum entdeckt. Sein Werk wurde 1762, also zwei Jahre vor dem Erscheinen des Philosophischen Taschenwörterbuchs, in Paris auf höchstrichterlichen Entscheid verbrannt.
1698 erschien von Pater Charles le Gobien (1652 – 1708) Nouveaux mémoires sur l’état présent de la Chine, Paris 1698, III.[1-2]. Diese Schrift wurde am 18. 10.1700 durch die Theologischen Fakultät in Paris zensiert, weil le Gobien die chinesische Ahnenverehrung nicht verdammte.
Von 1709 – 1743 veröffentlichte Jean Baptiste du Halde (1674 . 1743) seine Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise mit zahlreichen Karten und gezeichneten Darstellungen chinesischer Orte. Dt: Ausführliche Beschreibung des Chinesischen Reichs und der grossen Tartarey. Johann Christian Koppe, Rostock 1747–1756, Band I 1747, Band II 1748, Band III 1749, Band IV 1749, Zusätze 1756. Das Werk ist gewissermaßen die Zusammenfassung der über 100 jährigen Missionstätigkeit der Jesuiten in China, du Halde war zwar selbst nie in China, er verarbeitete jedoch die Berichte seiner Ordensbrüder zu einem sehr publikumwirksamen Werk. Es blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein das maßgebliche Standardwerk über China und beeinflusste die Diskussion über die chinesische Welt. Er achtete sorgsam darauf, die chinesische Kultur der europäischen stets unterzuordnen. Darin folgte ihm auch Denis Diderot , der in seinem Artikel „Chinois“ der Enzyklopädie v. 1753 behauptet, China sei rückständig, stehengeblieben und nur durch die europäischen Missionare wieder zu neuem, fortschrittlichen Wissen gelangt.
Die aufgeklärten Kreise in Frankreich und auch Deutschland diskutierten leidenschaftlich die Frage, ob und wie es sein könne, dass eine Gesellschaft wie die Chinesische über Jahrhunderte existierte, ohne wirklich an einen Gott zu glauben, ohne eine zentrale Religion zu haben. Pierre Bayle (Dictionnaire historique et critique, 2. Ausgabe von 1702) nahm China als Beispiel für eine Gesellschaft von Atheisten, die funktionierte, also ohne Religion auskam. Das brachte die christlichen Gegner zur Weißglut. Als Professor Christian Wolff (siehe dazu die Biographie: H. J. Kertscher, Er brachte Licht und Ordnung in die Welt. Christian Wolff – eine Biographie, Halle: mdv, 2018: dazu unsere Rezension) am 12. Juli 1721 in einem Vortrag auf Latein mit dem Titel „Rede über die praktische Philosophie der Chinesen“ in Halle ähnliches vertrat, waren seine Tage gezählt, die Pietisten um den Pfarrer Lange ruhten nicht, bis sie Wolff am 23 November 1723 außer Landes getrieben hatten (Es war 1740 eine der ersten Amtshandlungen Friedrichs des Großen, Wolff aus dem Exil zurückzurufen).
Man kann von einer wahren Chinabegeisterung im 18. Jahrhundert sprechen, chinesisches Porzellan, chinesische Seide, chinesische Tees waren gefragte und sehr teure Artikel bis hin zu Gebäuden im chinesischen Stil, wie sie noch heute die zahlreich vorhandenen Chinapavillons in den Schlossparks zeugen (etwa im Garten von Sans Souci in Potsdam). Während die klerikal-christlichen Kreise nach dem Ende der Jesuitenmission China verteufelten, wendete sich die Aufklärung China positiv zu.
Voltaire hatte bereits 1751 in seinem Siècle de Louis XIV (Kapitel 39) über die Feindseligkeiten gegen die erfolgreiche Missionstätigkeit der Jesuiten berichtet, die am Ende dazu führten, das sich China angeekelt vom Christentum abwandte.
1756 waren die ersten beiden Kapitel seines Essay sur les moeurs, mit dem er nichts weniger als die erste, nicht von christlicher Heilslehre verunreinigte Weltgeschichte publizierte, China gewidmet. Dieses umfassende, bis zu Ludwig XIII. im 17. Jhdt reichende Geschichtswerk, beginnt nach einem Vorwort mit der Geschichte Chinas und behandelt im zweiten Kapitel die chinesische Religion. Nach Voltaire resultiert die Zuschreibung Chinas als atheistische Kultur auf der Unart des Christentums, alles, was nicht seiner Lehre entspricht, als gottlos und als atheistisch zu verdammen:
„Wir haben die Chinesen nur deshalb verleumdet, weil ihre Metaphysik mit der unseren nicht völlig übereinstimmt. Wir hätten aber zwei ihrer Vorzüge bewundern sollen, nämlich, dass sie sowohl den Aberglauben der Heiden, als auch die Sitten der Christen verabscheuten“ (2.Kap., S. 34).
Er hält China nicht für eine Gesellschaft von Atheisten, denn die Zuschreibung „atheistisch“ sei falsch. Nach Voltaire hätten die Chinesen getreu der konfuzianischen Lehre doch an einen allmächtigen, hinter dem Kaiser stehenden Gott geglaubt. Der Essay sur les moeurs war im Übrigen das allererste Werk der Neuzeit, das die Geschichte der Welt nicht auf den europäischen Kontinent beschränkte und anerkannte, dass lange vor der europäischen Zivilisation in China eine dieser deutlich überlegene Hochkultur existierte.
Die Größe der chinesischen Kultur ist auch Thema in Voltaires Theaterstück „L’Orphelin de la Chine“ (1755), in dem der grausame Mongolenherrscher Dschingis Khan die Überlegenheit Chinas über das barbarische mongolische Reitervolk anerkennt.
Quellen:
– Voltaire, Oeuvres complètes, Oxford: Voltaire Foundation, 1968 – 2022, 205, hier: Bd. 35
– Etiemble, René, L’Europe Chinoise, Bd. 2: De la sinophilie à la sinophobie, Paris: Gallimard, 1898, 408 p.
– Tricoire, Damiens, Von der Sinophilie zur Sinophobie?: aufklärerische Geltungsansprüche und Chinabilder im 18. Jahrhundert, in: Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, 67, S.151-172
– Pinot, Virgile, La Chine et la Formation de l’Esprit Philosophique en France (1640-1740), Paris: Geuthner, 1932, 480 p.
Die folgenden Kommentare zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Anmerkung 1 (S.104, erster Absatz: „…dass sie zum frischgebackenen Adel gehörten…”): Bis 1727 musste man in Frankreich, um Staatssekretär zu werden, das Amt kaufen. Derjenige, der es kaufte, wurde sogleich geadelt, weshalb das Verfahren auch als „Gemeinenseife“ bezeichnet wurde. Deshalb gab es auch den netten Spruch: „Hätte Adam nur ein Quentchen Verstand besessen, er hätte sich das Amt des königlichen Staatssekretärs gekauft und die ganze Menschheit wäre adlig geworden“ (H. Méthivier, L’Ancien régime en France, Paris 1981, S. 80, nach: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, S. 530).
Anmerkung 2 (S. 105, erster Absatz und ff: „…ihn [Wolff] zu beschuldigen, dass er nicht an Gott glaube..“): Im Vorwort zu Voltaires Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) findet sich folgende Anmerkung: „So hat der Doktor Lange den respektablen Wolff als Atheisten tituliert, weil er die Moralität der Chinesen gelobt hatte; und als Wolff sich auf das Zeugnis der Jesuitenmissionare in China berief, antwortete der Doktor: ‚Weiß man denn etwa nicht, dass die Jesuiten Atheisten sind?’“. nach: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, Anm. 14, S. 532
Anmerkung 3 (S. 105, zweiter Absatz: „…die Regierung in Peking sei atheistisch..“): Noch 1730 war Voltaire der Annahme von Pierre Bayle (Dictionnaire historique et critique, 2. Ausgabe von 1702) vom Atheismus der gebildeten Chinesen gefolgt. 1755 jedoch schreibt er in Bezug auf China in einer seiner Tagesnotizen (Oeuvres complètes, 1968, 81, S.135): „Es gibt [in China] Atheisten, doch die Regierung ist nicht atheistisch und kann es nicht sein“. nach: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, Anm. 15, S. 533
Anmerkung 4 (S. 106 zweiter Absatz „…dass dort die Gesetze herrschten.…“): Nach Du Halde setzte Fuhi einen ersten Minister ein und teilte die Regierung des Reiches unter vier Mandarine auf: „So erlebten seine Gesetze eine Blütezeit“. (Description de la Chine, I.272-73, nach: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, Anm. 21, S. 536).
Anmerkung 5 (S. 106 zweiter Absatz „…und all die anderen Künste.…“): Im Essai sur les moeurs, erinnert Voltaire daran, dass die Chinesen seit zweitausend Jahren, lange vor den Persern, den Buchdruck erfunden haben und gelernt haben, Glas herzustellen; dass sie mit dem Hammer geprägte Münzen aus Gold und Silber hatten.
Anmerkung 6 (S. 106 dritter Absatz „…seltsame Berechnungen.…“): Denis Petau (1583-1652), damals ein berühmter Chronologe und Historiker in Paris, hatte berechnet, dass ein einziger Sohn Noahs eine Rasse hervorbrachte, die nach zweihundertfünfundachtzig Jahren sechshundertdreiundzwanzig Milliarden und sechshundertzwölf Millionen Menschen zählte. Voltaire: „Die Rechnung geht ein bisschen zu weit“ La Philosophie de l’histoire, Kap. 24, in Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation Bd. 59, S. 172).
Anmerkung 7 (S. 106 dritter Absatz, Ende „…wie wenig sich die Menschheit doch vermehrt.…“): Montesquieu u.a. behaupteten, die Bevölkerung der Erde im achtzehnten Jahrhundert sei zehnmal geringer als die primitive und dreißig mal geringer als die zu Zeiten Cäsars (Lettres persanes, CXIII). Voltaire bezweifelte diese Theorie: anstelle eines Bevölkerungsrückgangs schlägt er eine kontinuierliche Zunahme vor, die sich dem von der Menschheit gemachten materiellen Fortschritt verdankt, und geht so auch auf Abstand zu der These von Damilaville (in seinem Artikel ‚Population’ für die Enzyklopädie), für den die Weltbevölkerung immer ungefähr gleich geblieben ist. In den Augen Voltaires kann die Bevölkerungszunahme nur sehr langsam vonstatten gehen: die Kindersterblichkeit betrifft zumindest ein Drittel der Geburten; sie kann diese sogar um die Hälfte reduzieren. Questions sur l’Encyclopédie, 1770, Art. Population, (Œuvres compl. 1877-85, XX.247-48)
Anmerkung 8 (S. 107 oben „…Mandarine Stockschläge.…“): „Wie gefürchtet auch die Autorität dieser Mandarine sein mag, sie können kaum ihre Stellen beibehalten, wenn sie nicht in dem Ruf stehen, ein Vater des Volkes zu sein und nach nichts anderem als nach seinem Glück zu streben. […] Ein Mandarin, der zu streng wäre und bei dem man nicht diese Zuneigung zu dem Volk, das ihm unterstellt ist, bemerkte, würde mit Sicherheit negativ in den Berichten erwähnt werden, die alle drei Jahre von den Vizekönigen an den Hof gesendet werden, und diese Bemerkung wäre ausreichend, um ihn seine Stelle zu kosten“ (Du Halde, Description de la Chine, II, 31, nach: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, Anm. 32, S. 540)).
Anmerkung 9 (S. 107 oben „…die einzige Verfassung, die Preise für die Tugend ausgesetzt hat.…“): Im Essai sur les moeurs (Ende des 1. Kapitels) bringt Voltaire dazu folgende Anekdote „Vor einiger Zeit fand ein armer Bauer namens Chicou einen Beutel voller Gold, den ein Reisender verloren hatte. Er reiste bis in die Provinz des Reisenden und übergab den Beutel dem Magistrat des Kantons, ohne etwas für seine Mühen zu wollen. Der Magistrat, bei Strafe, abgesetzt zu werden, war verpflichtet, das Oberste Gericht in Peking zu benachrichtigen; dieses Gericht war verpflichtet, den Kaiser zu benachrichtigen, und der arme Bauer wurde zum Mandarin der fünften Ordnung ernannt, denn es gibt Mandarinsstellen für Bauern, die sich in der Moral auszeichnen, wie auch für diejenigen, die in der Landwirtschaft am erfolgreichsten sind. Man muss zugeben, dass man bei uns diesen Bauern nur dadurch ausgezeichnet hätte, dass man ihm eine höhere Steuer auferlegt hätte, weil man der Meinung war, dass es ihm wohl ergehen müsse.“
Anmerkung 10 (S. 107 zweiter Absatz „…geben wir auch noch zu.…“): All die hier von Voltaire angeführten Beispiele bringt Du Halde als Beleg für die Überlegenheit der europäischen Kultur, an der Voltaire durchaus zweifelt. (siehe auch: Oeuvres compl., Oxford: Voltaire Foundation, Bd. 35, 2011, Anm. 39, S. 542)