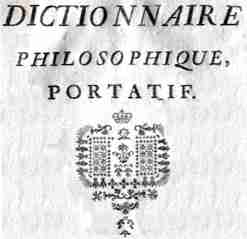Hintergrund:
Thomas Hobbes (1588 -1679) stellt sich der Idee vom „Guten an sich“ entgegen. Nach ihm liegt das Gute im Begehren und er stellt fest, dass wir nach immer weiterem „Guten“ begehren. Das Ende des Begehrens wäre gleichbedeutend mit dem Tod (Vom Menschen XI.15). Für John Locke (1632 – 1704) ist das Gute ganz einfach das, was Lust erregt (Versuch über den menschlichen Verstand II,21 §42 ff). Ähnlich ist auch der kleine Essay von Voltaires langjähriger Lebensgefährtin Emilie du Châtelet „Rede über das Glück“ zu verstehen, der bis heute nichts von seiner lebendigen Überzeugungskraft verloren hat: Glück wird darin nicht ethisch moralisch überhöht, sondern als Moment erstrebenswerten Wohlgefühls verstanden, von dem wir möglichst viele erleben sollten, um unser Leben angenehm zu machen. Emilie du Châtelet war auch die Erstübersetzerin der Bienenfabel von Manedeville, in der er behauptet, dass persönliche Tugend (Genügsamkeit, Friedfertigkeit) für den Fortschritt und die Prosperität der Gesellschaft weniger förderlich seien als zum Beispiel Luxus und Verschwendung.
Ganz anders die Philosophen der Antike, die sich mit dem, was als das höchste Gut anzusehen sei, auseinandersetzten. Was Menschen erstreben, was sie erreichen wollen, kann man als „das Gute“ bezeichnen. Es gibt Güter, die man nicht um ihrer selbst willen erstrebt, sondern um ein weiteres, höheres zu erreichen. Reichtum zum Beispiel wäre solch ein Gut, mit dem man sich anderes sichern will, etwa Wohlstand oder persönliche Unabhängigkeit. Welches ist aber dann das höchste aller Güter, das „summum bonum“? Und: ist es für alle das gleiche, oder ist es für jeden etwas anders?
Platon meint, Gerechtigkeit und Schönheit wären höchste Güter, denn sie erstrebe man um ihrer selbst willen und behauptet, dass wir die Idee eines absolut Guten in uns tragen, nach dem wir unser Handeln ausrichten. Die Vorstellung vom Höchsten Gut sei wie die Sonne, die alles erleuchtet, sie sei die Antriebskraft allen menschlichen Handelns (Politeia Kapitel VI).
An diese Vorstellung Platons vom höchsten Gut brauchte das Christentum nur seinen Gott anzuheften, als ein „summum bonum“, dem man zustrebt, das alles Handeln bestimmt und dem man schlussendlich im Jenseits begegnet. Ähnlich formulierte es Augustinus (De civitate Dei, [dt. Vom Gottesstaat], XIX).
In seinen kurzen Artikeln De la chimère du souverain bien und auch in Le songe de Platon aus dem Jahr 1756 kritisiert Voltaire die Ideenlehre Platons, weil in ihr Vorstellungen für Realität ausgegeben werden, die nur in Platons Theorie exisitieren.
Abschließend sei auf den Artikel „Bien“ des Abbé Claude Yvon in Diderot’s Enzyklopädie hingewiesen, der in der Tugend das höchste Gut erblickt und behauptet, dass einem das tugendhafte Leben post mortem im Paradies vergütet würde.
Die folgenden Kommentare zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):
Anmerkung 1 (S.68, zweiter Abschnitt: „[Das höchste Gut] .. uns ergötzt und unfähig macht noch etwas anderes zu empfinden“) Wie Voltaire an anderer Stelle schrieb : „Die Philosophie verspricht das Glück, aber die Sinne verschaffen es“ (carnets), so hält er sich auch hier an das sinnliche Empfinden: Das Gute ist mit der Lust verwandt, das Böse mit dem Schmerz.
Anmerkung 2 (S.68, dritter Abschnitt: Fabel von Kantor] .Die Fabel positioniert das Gute in die Nähe dessen, was Lust erregt und stammt ursprünglich von Sextus Empiricus (Kap. 3, ), wird aber auch in dem Enzyklopädieartikel (s.o.) wiedergegeben.
Anmerkung 3 (S.69, Voltaire lehnt die Auffassung von der Tugend als dem höchsten Gut ab. Tugendhaft zu sein, besteht für ihn allein darin, dem Nächsten Gutes zu tun (-> Artikel Vertu – Tugend).