Widerlegung scheinheiliger Behauptungen. Ein Essay von Rainer Neuhaus*
Wenn wir aufhören, Voltaire zu ehren,
sind wir für die Freiheit nichts mehr wert
(Will Durant)
Antisemitismus I: Die Aufklärung und ihre Gegner.
Voltaire ist schlecht für König, Kirche, Karitas, Voltaire ist gut für alle, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, lesen und schreiben können und sich kein X für ein U vormachen lassen wollen. Ob es einen Plan gibt, die Aufklärung durch den Antisemitismusvorwurf zu schwächen, oder nicht, das entsprechende Geschrei im Internet und Artikel wie der kürzlich in der Tageszeitung Die Welt (1) erschienene passen jedenfalls recht gut zum Zeitgeist, der aus ‚Antisemitismus’ und ‚Rassismus’ längst eine Waffe geschmiedet hat, die all jene zu spüren bekommen, die es wagen, aufgelegten Lügengespinsten mit eigenen Beobachtungen und Gedanken in den Weg zu treten.
Nicht nur, daß sich, befremdlich genug, mit der bloßen Behauptung, in der Tradition der Opfer des Holocaust zu stehen, Geld verdienen läßt, was vor allem diejenigen trifft, die das Andenken wirklich selbstlos bewahren, darüber hinaus dient sie selbsternannten Gralswächtern dazu, Humanisten, Pazifisten, Antiimperialisten, Antisemiten gleichermaßen zu Judenhassern zu erklären, ganz besonders dann, wenn jemand die Politik Israels und seiner Schutzmacht kritisiert. Auf solche Weise werden kriegerische und menschenfeindliche Motive ideologisch kaschiert und es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeit, um vorhersagen zu können, daß besagte Gralshüter in dem Augenblick zu Israelfeinden mutieren werden, in dem die Schutzmacht ihren Brückenkopf Israel nicht mehr zur Durchsetzung der eigenen Interessen benötigt.
Der Antisemitismusvorwurf gegen Voltaire, d’Holbach, d’Alembert, sogar Diderot, hat schon immer rückwärtsgewandten Kreisen dazu gedient, die Aufklärung an einem ihrer vermeintlich schwachen Punkte zu treffen. Ob es sich dabei um zionistische oder christliche Finsterlinge handelte, immer ging es in solchen Reden und Texten darum, eine unliebsame Lehre anzugreifen, indem man ihre Repräsentanten als moralisch fragwürdig erscheinen lässt, ein Mittel, so alt wie die Menschheit selbst (erinnert sei nur an Aristophanes, der Sokrates eines Manteldiebstahls beschuldigte, um dessen Religionskritik anzugreifen). Was Voltaire betrifft, hat man ihn auch schon einen schwierigen Charakter, geizig und als einen undankbaren Zeitgenossen gescholten, doch jetzt, wo der Antisemitismusvorwurf als Pfeil im Köcher der Mächtigen steckt und die Schriften Voltaires weitgehend unbekannt sind, ist, so steht zu befürchten, der Zeitpunkt günstig, gegen die Aufklärung zum entscheidenden Schlag ‚wegen Antisemitismus’ auszuholen. Sehen wir, was es mit dem angeblichen Antisemitismus Voltaires auf sich hat.
Antisemitismus II: Voltaire, die Juden und die Verfolgung Andersgläubiger.
Francois Marie Voltaire lebte 84 Jahre, von 1694 bis 1778. Im ersten Drittel seines Lebens wohnte er unter seines Vaters Namen ‚Arouet’ in Paris, dann unter seinem selbstgewählten Namen ‚Voltaire’ an wechselnden Orten in Frankreich, den Niederlanden, England und Deutschland, um dann ab 1753 in der vor Verfolgung sicheren Grenzregion um Genf, teils in Frankreich, teils in der Schweiz zu residieren. Erst in seinem Todesjahr 1778 ist er nach Paris zurückgekommen.
In seiner Heimatstadt Paris hat es damals sehr wenig Juden gegeben (einige hundert nur), Voltaire dürfte sie als ‚Gemeinde’ kaum wahrgenommen haben, allerdings kam er in Kontakt zu einigen ihrer herausragenden Mitglieder: er erwähnt zum Beispiel Silva, Leibarzt der Königin, den er schätzte und konsultierte. Judenverfolgungen im engeren Sinne hat es in Frankreich damals nicht gegeben, allerdings versuchte die Obrigkeit in Paris, deren Zuzug zu beschränken und die ansässigen Juden wurden von einem ‚Judenbeauftragten’ drangsaliert, der ihnen das Leben schwer machte und sich selbst nach Kräften an ihnen bereicherte. Nur im fernen Elsaß und in Bordeaux hat es eine bedeutende jüdische Gemeinde gegeben; nach Bordeaux waren zahlreiche portugiesische Juden vor der Inquisition geflüchtet und in den Elsaß sind viele Juden aus Polen gekommen, um sich gegenüber den sehr ärmlichen Verhältnissen dort ein besseres Leben aufzubauen.
Was es im Frankreich zu Lebzeiten Voltaires allerdings immer gegeben hat, war die Verfolgung von Protestanten, den sogenannten Hugenotten, denn 1685 war das seit Henry IV (ihm hat Voltaire ein berühmtes Epos gewidmet) geltende Gebot der religiösen Toleranz, das Edikt von Nantes, aufgehoben worden. Auf die Verfolgung Andersgläubiger seit jeher spezialisiert, konzentrierte sich die katholische Kirche sofort nach der Aufhebung des Toleranzediktes auf die Bekämpfung der Protestanten, setzte für sie Berufsverbote durch, zwang deren wohlhabende Familien, nur katholisches Personal anzustellen und unterdrückte brutal ihre Religionsausübung (wagten sie trotzdem, sich insgeheim zu versammeln, hat man die Prediger gefangengenommen und umgebracht). Es ist also festzustellen, dass sich die Kirche, um mit Voltaire zu sprechen: der Fanatismus, im 18. Jahrhundert in Frankreich auf die christlichen Abweichler konzentrierte und dass er die Juden, vielleicht, weil sie nicht sehr zahlreich waren, nicht im Visier hatte.
Stattdessen gab es aber Versuche, die jüdische Tradition für das Christentum zu beerben und das ging ungefähr so: die Juden waren zu Anfang Gottes auserwähltes Volk, sie haben sich aber schlecht benommen, als sie Christus ablehnten – da war es mit der göttlichen Gnade ganz vorbei. Gott hat sie deshalb verstoßen und seinen Sohn veranlasst, eine eigene Christenpartei zu gründen, deren Mitglieder seitdem seine wahren Parteigänger sind. Die Juden sind solchermaßen die älteren Verwandten der Christen und brauchen bloß zum Christentum überzutreten, um vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Der Theologe, der solches, natürlich mit wohlgesetzten, anderen Worten, vor allem predigte, war der einflussreiche Hofprediger Bossuet, der mit seinem Buch Discours sur l’histoire universelle (1681) dem Thronfolger Ludwig XV. erklärte, daß die Welt in der Geschichte immer perfekter, d.h. immer christlicher geworden sei und daß sie das nur bleiben könne, wenn das Christentum auch weiterhin die Macht ausübe.
Antisemitismus III: Voltaire und die jüdische Religion.
Nur wer diesen Hintergrund kennt, ist in der Lage, Voltaires Haltung zum Judentum zu beurteilen. Voltaire hatte ebenso eine Meinung zur jüdischen Religion, wie er ein Meinung zum christlichen Glauben und zum Islam hatte. Er forderte religiöse Toleranz und erkannte die tödliche Gefahr für die Freiheit, wenn es einer Religion gelingt, sich an die Macht zu schwingen: „Habt ihr bei euch zwei Religionen, werden sie sich die Kehle durchschneiden, habt ihr dreißig, leben sie miteinander in Frieden“.
Außerdem war Voltaire ein entschiedener Gegner aller monotheistischen Offenbarungsreligionen, also der Religionen, die die Auffassung vertreten, dass außer ihren Berufsspezialisten, den Priestern, niemand beurteilen kann, was wahr oder falsch, richtig und gut, schön oder hässlich ist. Was daran liegen soll, daß Gott ihnen und nur ihnen seine Worte (‚die Wahrheit’) übermittelt hat – die soooo schwierig zu interpretieren sind, daß außerhalb der Kirche dieses Geschäft niemand beherrscht. Voltaire kritisierte die Anmaßung, die in allen monotheistischen Offenbarungsreligionen steckt und er erkannte, dass, wer solches glaubt und behauptet, Andersdenkende immer verfolgen wird, wenn er nur erst die Macht dazu besitzt, denn jeder Abweichler ist eine lebende Widerlegung ihres Gründungsmythos mit integriertem Alleinvertretungsanspruch.
Voltaire hat infolgedessen auch das Judentum an vielen Stellen kritisiert: – bei seiner Kritik am Alten Testament und am historischen Judentum, – wenn er nachweist, daß die Behauptung von der Offenbarung den Glauben vom auserwählten Volk Gottes nach sich zog und daraus, ähnlich wie später beim Christentum, Verfolgungsaktionen gegen Andersgläubige hervorgingen, – wenn er das Judentum seiner Zeit als Bastion des Aberglaubens, damit als Gegner der Aufklärung ansieht. Außerdem gibt es (wenige) Briefstellen, die vermuten lassen, daß es bei Voltaire auch Überbleibsel des christlichen Antisemitismus gegeben hat, die auf den alten Vorwurf der ‚Käuflichkeit’ und den der ‚Organisation jüdischer Seilschaften’ zurückgehen. Dagegen hat Voltaire das Judentum immer gegen die Verfolgung durch die katholische Inquisition verteidigt, in seiner bisher noch nie ins Deutsche übersetzten Schrift Sermon du Rabbin Akib (2) hat er alle Argumente zu einer Verteidigungsrede zusammengefasst, die auch heute noch Gültigkeit beanspruchen können.
Voltaires Kampf für religiöse Toleranz, also für die Gleichberechtigung aller Religionsgemeinschaften war ein Kampf gegen den Hauptfeind, gegen die mörderische katholische Kirche und ihre Inquisitionsgerichte. Er bekämpfte sie, die er unter dem Begriff der ‚Infâme’ zusammenfasste, an vielen Fronten. Bekannt geworden sind vor allem die drei spektakulären Kampagnen, in denen Voltaire gegen die Verurteilung Andersdenkender zum Tode für deren Rehabilitation kämpfte. Es handelt sich um das Todesurteil gegen Jean Calas in Toulouse 1762, den die Kirche und ihre Helfershelfer unter fadenscheinigen Anschuldigungen in Toulouse aufs Rad hatte flechten lassen (3), 1764 gegen Jean Paul Sirven, den man, wiederum in Toulouse, wie Jean Calas rädern lassen wollte – Voltaire erreichte seinen Freispruch – und gegen den Chevalier de la Barre, den man am 1.Juli 1766 in Abbéville hingerichtet hat, weil er eine Prozession nicht ehrerbietig gegrüßt hatte. In vielen seiner Theaterstücke zeigte er die Menschenfeindlichkeit der Kirche und ihrer Vertreter, nicht zuletzt deshalb werden sie heute nicht mehr aufgeführt. Er forderte religiöse Toleranz und kritisierte in zahlreichen Schriften, vor allem in seinem Philosophischen Wörterbuch, den christlichen Glauben selbst.
Das war allerdings nur unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen möglich, daher versteckte Voltaire sich selbst in Ferney, der äußersten Ecke Frankreichs und er versteckte seine Kritik, indem er zum Beispiel eine Diskussion um Religionsfragen in China stattfinden ließ, ein Theaterstück zum Fanatismus unter dem Titel Mahomet und nicht etwa unter ‚Paulus’ veröffentlichte und indem er sich das alte Testament, also die Grundlage, das Fundament des Christentums, unter dem Vorwand, die jüdische Religion zu kritisieren, vornahm. Adressat dieser Kritik ist nicht ein zu Voltaires Zeit gar nicht vorhandenes jüdisches Volk, er wendet sich an das Christentum selbst und an seine Vertreter, ihnen weist er nach, wie das Volk Gottes war, dessen göttlich legitimierter Nachfolger sie zu sein behaupten. Gerade daraus versuchen ihm aber heutige Gegner der Aufklärung einen Strick zu drehen. Wer die jüdische Religion – Adressat hin oder her – polemisch und satirisch ins Visier nimmt, hat sich nach diesen heutigen Hofpredigern mitschuldig am Holocaust gemacht. Es ist absurd: gerade Voltaire, dem wir die klare Idee persönlicher Unabhängigkeit, die Forderung der religiösen Toleranz und eine Vorstellung davon, was es heißt, sich für diese Ziele einzusetzen, verdanken, soll ein Antisemit gewesen sein, er, der die entscheidende Schwächung der Inquisition bewirkte? Credo quia absurdum est!
Antisemitismus IV: Ecrasez l’Infâme!
Den Zeitgenossen Voltaires dürfte die Zielrichtung seiner Kritik am Judentum klar gewesen sein, denn sie kannten Stellen wie die folgenden, an denen, tauscht man nur das Wort christlich gegen jüdisch aus, die Mechanik der Maskerade vieler anderer, angeblich ‚antijüdischer’ Stellen klar und deutlich hervortritt: „Ihre unverträgliche, intolerante Sekte wartete [zur Zeit des römischen Reiches] nur darauf, die unumschränkte Freiheit zu besitzen, um dann der übrigen Menschheit die Freiheit zu rauben.“ (319); „Zum Schluß stelle ich fest, daß jeder vernünftige, jeder anständige Mensch die christliche Sekte verabscheuen muß.“(Lord Bolingbroke, S. 370); „Möge unser großer Gott, der mich hört, dieser Gott, der gewiß nicht von einer Jungfrau geboren sein kann, noch an einem Kreuz gestorben ist, noch in einem Stück Brot gegessen werden kann, noch die Bücher voll von Widersprüchen und Schrecknissen inspiriert haben kann, möge dieser Gott, der Schöpfer der Welten, Erbarmen haben mit dieser Sekte der Christen, die ihn lästern“ (Sermon des Cinquante).
Voltaires Forderung nach Toleranz für alle Religionen ist in seinem Werk derart präsent, daß die Behauptung des Gegenteils von der finsteren Absicht der Voltairekritiker selbst zeugt. Hierzu nur zwei Textstellen als Beleg: „Ich sage euch, daß man alle Menschen als unsere Brüder anzusehen hat. Was? Mein Bruder der Türke? Mein Bruder der Chinese? Der Jude? Der Siamese? Ja, zweifellos; sind wir nicht alle Kinder desselben Vaters, Wesen desselben Gottes?“ (Traité de la Tolérance); „Es sollten doch die Wortverdreher, die in ihrem eigenen Bereich so viel Nachsicht nötig haben, endlich aufhören diejenigen zu verfolgen und auszulöschen, die als Menschen ihre Brüder und als Juden ihre Väter sind. Jeder diene Gott in der Religion, in die er hineingeboren wurde, ohne seinem Nachbarn das Herz herausreißen zu wollen, durch Streitereien, bei denen niemand den anderen versteht.“ (Sermon du Rabbin Akib).
Und wie lautet die Schlussfolgerung aus alledem? Mit der eigentlich leicht durchschaubaren Antisemitismus-Finte will das Christentum, wollen seine Nachfolger, Voltaire, einen ihrer entschiedensten Kritiker erledigen (dass Islamisten wie Tareq Ramadan beim Erledigen keineswegs abseits stehen, zeigte er 1993 in Genf), um der Aufklärung, um dem selbst denkenden, antiautoritären Menschen den Garaus zu machen.
Die Dreckschleudern gegen die Aufklärung stehen niemals still, haben niemals stillgestanden, und werden nicht stillstehen, jedenfalls nicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem Voltaires Schlachtruf, den man heute etwas umfassender, nicht nur im antikirchlichen Sinne verstehen sollte, verwirklicht ist: „Ecrasez l’Infâme“!
*Rainer Neuhaus ist verantwortlicher Redakteur der Voltaire-Internetseiten www.correspondance-voltaire.de, die er im Namen der Voltaire-Stiftung herausgibt.
(1) Die Welt, 27.7.2012.
(2) Die Übersetzung findet man als Anhang des weiterführenden Seiten Voltaire – Juden, Antisemitismus?
(3) Siehe ausführlich zur Affaire Calas
Widerlegung scheinheiliger Behauptungen Voltaire – ein Antisemit? als pdf herunterladen.

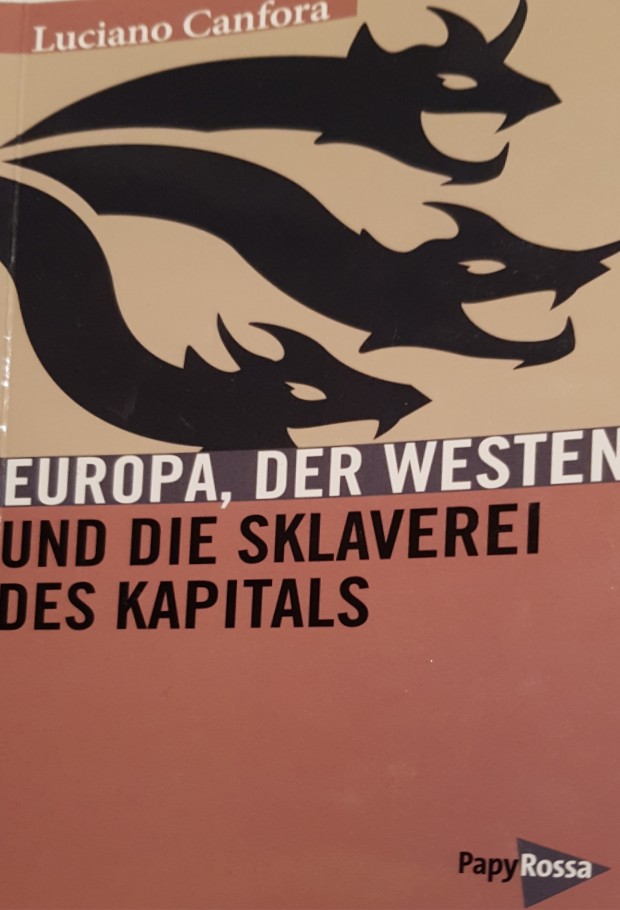



 Nach 1945 stand an der Stelle des Marquisats ein großes Wohnhaus und zu DDR Zeiten erinnerten, zumindest bis zum Abriss des Gebäudes, zwei Gedenktafeln an die berühmten Bewohner, Lessing und Voltaire. Man kann die Tafeln auf dem Photo hier ganz gut erkennen (Märkische Volksstimme,1987):
Nach 1945 stand an der Stelle des Marquisats ein großes Wohnhaus und zu DDR Zeiten erinnerten, zumindest bis zum Abriss des Gebäudes, zwei Gedenktafeln an die berühmten Bewohner, Lessing und Voltaire. Man kann die Tafeln auf dem Photo hier ganz gut erkennen (Märkische Volksstimme,1987):
 Die abgerissenen Bronzetafeln müsse man wohl in der Havelbucht suchen, meint der Autor Ehrhart Hohenstein am Ende seiner informativen 4 teiligen Artikelserie über die Geschichte des Marquisat und seiner Bewohner. Und: "Das Andenken Voltaires wird in seinem einstigen Aufenthaltsort immer noch recht stiefmütterlich behandelt". Daran hat sich bis heute (2015) nichts geändert.
Die abgerissenen Bronzetafeln müsse man wohl in der Havelbucht suchen, meint der Autor Ehrhart Hohenstein am Ende seiner informativen 4 teiligen Artikelserie über die Geschichte des Marquisat und seiner Bewohner. Und: "Das Andenken Voltaires wird in seinem einstigen Aufenthaltsort immer noch recht stiefmütterlich behandelt". Daran hat sich bis heute (2015) nichts geändert.





























