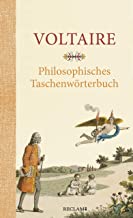Voltaire: Ein konservativer Umstürzler.
Peter Hacks: Über Voltaires Dramen (Ödipus Königsmörder)
Von Rainer Neuhaus*
veröffenlicht in: ARGOS Mitteilungen zu Leben, Werk und Nachwelt des Dichters Peter Hacks (1928-2003), Heft 5, November 2009: VAT-Verlag, 230 S.
Einen eigenartigen Text hat uns Peter Hacks mit seiner Analyse der Dramen Voltaires hinterlassen, so fremd, dass ihn bisher noch niemand gewürdigt hat und dass sich gewiss noch mancher Zeitgenosse daran die Zähne ausbeißen wird. Wer sich aber damit befasst, kommt nicht umhin, das sei vorangestellt, sich an der Gleichung Voltaire = Hacks zu orientieren.
Es wäre aber zu billig, sich von dieser ausgehend direkt ins Interpretieren von biographischen Bezügen zu stürzen, obwohl man dazu durch mancherlei Hinweise im Text verführt wird – zu billig deshalb, weil Peter Hacks über Voltaire schreibt und nicht über Hacks und auch an diesem Gegenstand gemessen zu werden verdient. Der Gegenstand ist groß: Voltaire, der ein ganzes Jahrhundert verkörpert – und schwierig, denn es geht dabei um einen großen Vergessenen, den Dramatiker Voltaire – zu Unrecht vergessen, wirft Peter Hacks ein: „Ein Land, das seine Stücke nicht auf dem Spielplan hat, hat keinen Spielplan“ und in Deutschland gibt es außer den recht freien Übersetzungen des Tancrède und des Mahomet von Goethe, die ohnehin, Mahomet angeblich aus Furcht vor islamistischen Terroranschlägen, nicht gespielt werden, keine einzige brauchbare und verfügbare Ausgabe der wichtigsten Theaterstücke Voltaires.
Die Dramen Voltaires.
Sie handeln nach Peter Hacks von hochpolitischen Dingen, mit dem Zeug zu Klassikern ihres Genres und ihres Zeitalters – des Absolutismus – der zu Voltaires Lebzeiten bereits im Niedergang begriffen war. Voltaire: Klassiker also einer Epoche in der Zeit ihres Untergangs – in dieser Beschreibung erkennt sich Hacks in Voltaire sogleich wieder und benennt die Parallele in einer erstaunlichen Passage:
„Wie stellt sich Voltaire zur Wende? Was ist Genie? Genie ist die Neigung zu der Annahme, dass der Weg, den die Allgemeinheit einschlägt, wahrscheinlich der falsche ist. Genie ist die Eigenart, sich durch das Schicksal der Nation stärker beeindrucken zu lassen als durchs eigene Wohlergehen….Er empfand, was alle als Eintreten der Freiheit sahen, als Beginn der Sklaverei, er durchschaute den Scheinfortschritt als Verrat an Frankreich.“(455/456).
Doch auf diese Parallele wollen wir, wie schon gesagt, erst später eingehen.
Alle Dramen Voltaires haben, Hacks zufolge, ein einziges Leitthema: sie betrauern den Untergang des großen Zeitalters Ludwig XIV. Das tun sie, indem sie die Schwächen, die Liederlichkeit und Verkommenheit der nachfolgenden Herrscher vor Augen führen, Schwächlinge oder Bösewichte, denen Voltaire einen wiederauferstandenen Louis XIV gegenüberstellt, als Geist in Shakespeares Manier (in Sémiramis), als legitimer Beherrscher Mekkas (Mahomet), als Laios im Drama Ödipus, oder als aus 20jähriger Gefangenschaft auftauchender Christenkönig Lusignan (Zaire).
Folgendermaßen haben wir den Inhalt der Tragödie ‚Ödipus’ nach Voltaire auf unseren Internetseiten (www.correspondance-voltaire.de) wiedergegeben:
Die Familie bringt Ödipus bekanntlich von A bis Z Verderben und Unglück, er tötet, ohne zu wissen, um wen es sich handelt, seinen Vater Laios im Kampf und heiratet Ioakaste, seine Mutter. Das Drama endet ‚klassisch‘ mit der Selbstblendung des verzweifelten Ödipus und dem Freitod Iokastes. In Voltaires Theaterstück war jedoch Iokaste vor ihrer Heirat mit Laios, – abweichend vom klassischen Vorbild des Sophokles – leidenschaftlich in Philoktet verliebt. Sie heiratete trotzdem Laios – aus Staatsraison. Und, als nach Laios Tod eine Heirat mit Philoktet erneut möglich gewesen wäre, folgt sie wieder der Staatsraison und gibt Ödipus das Jawort. Zweimal hätte Iokaste, wäre sie nur der Stimme ihres Herzens gefolgt, das Schicksal abwenden können. Durch die Einführung der Liebesbeziehung Philoktet – Iokaste als Parallelhandlung erscheint bei Voltaire das göttliche Urteil über Ödipus und Iokaste bedeutend weniger schicksalhaft und unabwendbar als in der klassischen Vorlage. Diese obrigkeitskritische Tendenz gipfelt in Aussagen wie der des Araspe mit dem zentralen Grundsatz der Aufklärung: „Ne nous fions qu’à nous, voyons tous par nos yeux, ce sont là nos trépieds, nos oracles, nos dieux“ (Vertrauen wir nur uns selbst, sehen wir alles mit unseren eigenen Augen. sie sind unsere heiligen Gefäße, unsere Orakel, unsere Götter“).
Sicher, wir haben die politische Symbolik sehr vernachlässigt – Peter Hacks würde uns das bestimmt ärgerlich vorhalten, stellt er doch den Inhalt des Ödipus folgendermaßen vor:
„Lajos, der sehr große und sehr alte König von Theben, ist von einem Verwandten zweifelhafter Herkunft, dem Ödipus, totgeschlagen worden; dieser hat die Nachfolge angetreten und des Vorgängers Leitungs-Cadres verbannt. Unermessliches Elend verbreitet sich über das Königreich Theben. Alles geht zu Grunde, und Hoffnung bleibt am Ende nur auf des toten Königs Sohn, den kleinen Prinzen“.(456)
Im weiteren Verlauf seiner Analyse vergleicht Hacks die für den Ödipusstoff zentrale Schuldthematik bei Voltaire, Corneille, Sophokles:
– bei Voltaire sei Laios im Recht, Ödipus aber ein Gauner („Schubiak“), seine Regentschaft ein Rückschritt, seine Schuld folglich nicht tragisch, sondern wirklich, während bei Corneille Ödipus’ Regentschaft gesellschaftlichen Fortschritt bedeute, dem sich die Schuld tragisch widersetze,
– bei Sophokles liege die Schuld Ödipus’ ganz anders in der Einführung des Vaterrechts, der patriarchalischen Revolution, die Tragödie bestehe dort aus der Idee, „dass ein Mann über genug Stolz und Trotz verfügt, die Wahrheit über sich herausbringen zu wollen“(458)
Hacks sieht darin seinen Schluss bestätigt, dass Voltaires Ödipus den Niedergang Frankreichs nach dem Tod Louis XIV. widerspiegle, das Stück sei unvermittelt Gegenwartsdrama (und nichts anderes), es werde von Personen der damaligen Zeitgeschichte bevölkert, die nur andere Namen tragen: dem Inzest treibenden Regenten Philippe d’Orléans, von Bischöfen, von aus Staatsraison heiratenden Königinnen, es habe keine darüber hinaus weisende Bedeutung. Er betont damit eine wichtige Dimension zum Verständnis des Stücks, eben den politischen Rahmen, auf den es sich bezieht, bleibt aber der nicht weniger zentralen psychologisch-biographischen Ebene, auch schon in seiner Bemerkung zu Sophokles, fremd, so als wolle er um jeden Preis zum Beispiel einen psychoanalytischen Zugang vermeiden.** Ein weiterer, noch entscheidenderer Mangel ist aber die fehlende Berücksichtigung der religionskritischen und antiklerikalen Tendenz des Werkes, womit sich Hacks einer eingehenden Analyse der Tragödie entzieht.
Ohne Zweifel hat Voltaire Louis XIV sehr verehrt, er schätzte in ihm den Förderer der Künste, des Handwerks und der Wissenschaft, denjenigen, der der Kleingeisterei des Feudalismus in Europa ein Ende gesetzt hat und er verachtete dessen Nachfolger, betrachtete deren Regierungszeit als Rückschritt. Er kritisierte jedoch auch die Aufhebung des Edikts von Nantes unter Ludwig XIV. und die Ruinierung der Staatsfinanzen durch seine übermäßige Prunksucht und überflüssigen Kriege. Voltaire als politischer Schriftsteller hat den von fanatischen Kirchenkreisen angeleiteten Mächtigen immer wieder in die Speichen gegriffen, Speichen eines Rades, durch die noch zu seiner Zeit Menschen lebendigen Leibes geflochten wurden. Aber gerade diese antiklerikalen Schriften gewinnen seltsamerweise Hacks Aufmerksamkeit nicht, im Gegenteil, er sieht in ihnen Nebensächliches: „.er (Voltaire) verrennt sich in einen Kampf mit dem Christentum ….der Kampf der Aufklärung gegen den Aberglauben ist ein Rückzug aus der vorhandenen Welt ins Geisterreich“(401). Damit aber lässt Hacks mindestens den halben Voltaire beiseite. Nehmen wir an, er interessiere sich eben als Dramatiker für die andere Hälfte, die vergessene, für Voltaire, den Dramatiker, so haben wir damit nicht gerade viel gewonnen, denn bei der Interpretation der Dramen tritt uns dieselbe Problematik erneut entgegen, da nicht wenige eine klare religionskritische Stoßrichtung haben und ohne sie kaum verstanden werden können. Auch beschränkt sich Hacks nach seiner eigenen Aussage nicht einfach auf einen Teil von Voltaire, den Dramatiker, er meint durchaus den ganzen Voltaire, denn der ist ihm zufolge Dramatiker durch und durch, selbst die Erzählungen und Romane seien nichts als Dramen nach dem Untergang des Dramas: „Die Menschheit, sagen die Romane, ist die Hölle des Menschen. Die Hölle ist das Chaos, und das Chaos ist dumm. Das durchaus Vernunftlose kann kein dramatischer Entwurf sein. Der Umgang mit dem Grässlichen ist so gepflegt, dass Fühllose die Romane für Humoresken halten und Rohheit sie zur Unterhaltung liest“. (501) Hacks, soviel steht fest, hat das für sich Wesentliche bei Voltaire jenseits der Religionskritik gesucht – und gefunden.
Sehen wir uns als Nächstes Peter Hacks‘ Interpretation des Dramas an, mit dem Voltaire seinen Ruhm in Paris gefestigt hat, der „Zaire“. Hier wiederum zunächst den Inhalt, wie wir ihn auf den Internetseiten wiedergeben:
Zaire, christlich geboren, lebt seit früher Kindheit im Serail des Sultans. Orosman, sein Sohn, und Zaire lieben sich und Orosman, nach dem Tod des Vaters selbst Sultan, will Zaire heiraten. In den Verliesen des Serails schmachten seit vielen Jahren einige hundert Christen, deren Kreuzzug zur Eroberung Jerusalems auf diese Weise endete. Zwei von ihnen beschwören Zaire, von der Heirat Orosmans abzusehen, die sie als Verrat am Christentum und – denn sie erweisen sich als Zaires Vater und Bruder – an der Familientradition ansehen. Orosman vermutet im Bruder Zaires aber ihren heimlichen Liebhaber, glaubt deren Flucht zu entdecken und ersticht Zaire als vermeintliche Verräterin. Als er die Wahrheit erfährt, entlässt der verzweifelte Orosman großmütig alle Christen aus der Gefangenschaft und tötet sich schließlich selbst. Orosmans Tat ist von Eifersucht gesteuert, aber Zaire hat ihren Tod heraufbeschworen, weil sie, indem sie zum Christentum übergeht, der Stimme des Blutes folgt und ihre Liebe verrät. Wenn es eine Moral in Voltaires Zaire gibt, so ist es diese: die Herkunft, die Familie, das Blut, sind Steine am Hals der Freiheit. Frei sein kann nur, wer sich von solchen Banden losmacht und seiner inneren Stimme, den eigenen Wünschen, folgt. Eine Fähigkeit, die sich Voltaire selbst lebenslang bewahrt hat.
Voltaire zeigt in Zaire, dass die Umgebung, in die man zufällig gerät, darüber entscheidet, welche Religion man annimmt, keine kann auf den einzig wahren Glauben Anspruch erheben. Die Spannung der Tragödie lebt vom Hin- und Hergerissensein Zaires zwischen ihrem schlechten Gewissen, ihrem Pflichtgefühl gegenüber Vater, Bruder und christlicher Religion und der Stimme ihrer Liebe zu Orosman. Ihr Vater, Lusignan, ist schwach und stirbt alsbald. Der Bruder Zaires, Nerestan, fällt durch seinen abstrakten Dogmatismus auf, den das Glück Zaires, seiner Schwester, kalt lässt. Bei der Gestaltung von Vater und Bruder hat Voltaire unverkennbar biographische Elemente eingearbeitet: Voltaires Vater und auch sein Bruder Armand waren gläubige Jansenisten, die ihn soweit es ging vom Erbe ausschlossen. Die Tragödie enthält keine adelskritischen Elemente außer einem Appell an alle Herrscher der Welt, sich am Großmut Orosmans ein Beispiel zu nehmen. Die Sprengkraft der Zaire liegt nicht hier, sondern in der Kritik am christlichen Fanatismus, der das Glück des Einzelnen kirchlichen Dogmen opfert und dabei ohne Gewissensbisse über Leichen geht.
Einer anderen Interpretation*** zufolge geht es Voltaire darum, Christentum und Islam, mit dem er sich in dieser Zeit intensiv zu beschäftigen begann, miteinander zu konfrontieren und dabei zu zeigen, dass die gefährlichen, den Fanatismus fördernden Überlegenheitsansprüche des Christentums unbegründet sind. So sagt Zaire vom Muslimen Orosman:
„Généreux, bienfaisant, juste, plein de vertus,
s’il était né chrétien, que serait-il de plus? (IV,1)
(Großzügig, wohltätig, gerecht, voller Tugend,
wäre er christlich geboren, was wäre er dann mehr?“)
Hacks dagegen setzt Orosman mit Philppe d’Orléans gleich, also mit einem unrechtmäßigen Herrscher und Gauner. Unrechtmäßig ist Orosman im Stück jedoch nur in den Augen von Lusignan, dem Christenkönig, an keiner Stelle aber ein Gauner. In Lusignan sieht Hacks Ludwig XIV, der im Kampf um Zaire, die für Frankreich stehe, den Sieg davon trägt und sie zum rechten Glauben, dem des Absolutismus, zurückführe. In einer Nebenlinie seiner Argumentation identifiziert Hacks Zaire dann noch mit einer Maitresse, gar mit der Pompadour, die jedoch, gesteht Hacks selbst ein, erst zwölf Jahre nach Mahomet an den Hof kam. Doch weist er diesen Einwand humorvoll zurück: „Dichter haben ihre Nasen einmal in der Zukunft stecken“(468) und lässt sein Interpretationsschema unberührt.
Hatte Hacks bei Ödipus die religionskritische Tendenz nur übersehen, so muss er nun bei Zaire, um sein Interpretationsschema aufrecht zu erhalten, schon beide Augen schließen und außerdem die Figur des Orosman, den man getrost als Vorbild für Lessings Nathan ansehen kann, ins Gegenteil verkehren.
Sehen wir uns, um den Sachverhalt weiter zu klären, Hacks Interpretation eines der bedeutendsten Theaterstücke Voltaires, des Mahomet an. Bekanntlich stellt Voltaire im Mahomet die These der Religionsstiftung durch Priesterbetrug in den Mittelpunkt. Ist Mahomet nur ein machtbesessener Betrüger (er erfindet eine göttliche Eingebung, um seinen kühl berechneten Strategien zur Eroberung Mekkas und zur Beseitigung des alten Statthalters eine höhere Weihe zu verleihen), sind seine Anhänger bereits überzeugte Fanatiker, die vor einem Meuchelmord am Statthalter Mekkas nicht zurückschrecken. Dass sie dabei, ohne es zu wissen, ihren eigenen Vater ermorden, verstärkt die Dramatik der Handlung und denunziert gleichzeitig den Fanatismus als fremd geleiteten Irrsinn, ein immer wiederkehrendes Thema bei Voltaire.
Hacks erklärt, Mahomet sei „die Tragödie des französischen Königtums“; beim alten Statthalter Mekkas handle es sich um niemand anderen als um den alten König Louis XIV, der durch die Fronde, also Hochadel und verbündetes Bürgertum in Form der bigotten Jansenisten, beseitigt werde. Indem er die Attentäter als heimtückisch, verlogen, fanatisch, meuchelmörderisch charakterisiere, meine Voltaire den Feudaladel, der in Frankreich nach der Macht greife. Dies alles habe Voltaire in der Mahomet-Fabel bloß versteckt und damit aber einen Fehler begangen, weil die Zensur dadurch ein Verbot des als religionskritisch ausgegebenen Stücks sehr leicht durchsetzen konnte.
Wie konnte Peter Hacks übersehen, dass Mahomet einen vorläufigen Höhepunkt in Voltaires religionskritischem Schaffen darstellt und den Auftakt für eine ganze Reihe weiterer antiklerikaler Werke bildet, derart klassisch in dieser Hinsicht, dass ihn unser bedeutendster Klassiker, Goethe, Wert genug fand, ihn selbst ins Deutsche zu übersetzen? Wie konnte Peter Hacks diese Kampfschrift gegen allen Fanatismus als bloßen Abgesang auf Louis XIV reduzieren?
Zunächst muss gesagt werden, dass Hacks Beharren auf dem gesellschaftspolitischen Bezug des Mahomet sowie auch der anderen Stücke keine geringe Leistung darstellt. Wenn er mit Voltaire im Absolutismus eine Errungenschaft und im Feudalklüngel, der Fronde, eine Gefahr, eine rückwärtsgerichtete Kraft sieht, verteidigt er den politischen Voltaire gegen seine selbsternannten humanistisch-toleranzduseligen Freunde und trägt damit möglicherweise heute mehr zur Neubelebung der Stücke bei, als durch das Wiederholen der gängigen Interpretationen. Dadurch befreit er Voltaire aus der Umarmung ziemlich verschlafener Kreise, die dessen Stücke, ihres politischen Kerns entledigt, der Langeweile und schließlich auch dem Vergessen ausgeliefert haben. Ein Drama, soll es Bestand haben, lebt nämlich, so Hacks, nicht davon, dass es die Religion kritisiert, auch nicht den Fanatismus. Ein Drama lebt davon, dass es im Kampf um die Macht Position bezieht. Wenn auch für Voltaire die Religionskritik große Bedeutung hatte und sie mit dem ‚Kampf um die Macht’ untrennbar verbunden war, so scheint auf der Grundlage der Interpretation Hacks, die Voltaire stärker in die Nähe Shakespeares rückt und seinen politischen Charakter hervorhebt, eine Wiederbelebung der Stücke heute, wo der Religion mancher Flügel gestutzt wurde, am ehesten möglich, etwa nach folgender sehr ernst gemeinten Empfehlung zur Aufführung von Voltaires ‚Sémiramis’: „Die Sémiramis“,.. ist ein empfehlenswertes Stück, und ein überaus anwendbares, falls Sie einen König haben, der nicht recht weiß, was er will“(474) – wir werden auf diese Empfehlung später noch einmal zurückkommen.
Andererseits ist das Bestreben Hacks, den antiklerikalen Kampf Voltaires auf einen Nebenkriegsschauplatz zu verbannen, ja, ihn sogar als Ergebnis der Isolierung und Emigration Voltaires in Ferney zu interpretieren, so auffällig, dass, wer das verstehen will, sich auf die zweite Ebene des Essays, nämlich seine Funktion als Positionsbestimmung Peter Hacks, einlassen muss, denn dahinter, hinter der Religionskritik, vermutet Hacks den politischen Voltaire, mit dem er sich verbunden weiß. Dieser Voltaire sei, positiv verstanden, konservativ, in der Vergangenheit das Gute sehend, das aber zunehmend zerfalle, er verteidige den Absolutismus gegen die nachfolgenden monarchischen Herrschaftsformen und Friedrich Engels täusche sich, wenn er sage, dass für Voltaire die Geschichte immer die Geschichte des Fortschritts sei. Hacks wäre zu entgegnen, dass sich Engels vielleicht täusche, was Voltaires Einschätzung der Herrschaftsformen seiner Zeit angeht, dass sich aber Hacks täuscht, wenn es um Voltaires Einschätzung der Entwicklung von Wissenschaft und Kunst, sowie industriell-handwerklicher Fertigkeiten geht. Hier steht Voltaire klar und deutlich für den ungebrochenen Fortschrittsglauben der Aufklärung, an dessen Umsetzung in die Realität er zeitlebens aktiv gearbeitet hat, etwa durch die Popularisierung der Werke Newtons, zahlreiche Artikel in seinem bahnbrechenden Philosophischen Wörterbuch und die Bekämpfung der klerikalen Bevormundung der Wissenschaft. Voltaire war im besten Sinne antiautoritär, dies nicht nur im Sinn der Religions- und Kirchenkritik, sondern auch charakterlich, was sich leicht aus seiner Biographie erschließen lässt und was unbedingt in eine Analyse seiner Dramen hineingehört, eine Unterlassung bei Peter Hacks, die, wie schon mehrfach erwähnt, mit seiner eigenen Situation im Deutschland der Wendezeit zu tun hat. Dieser Thematik wollen wir uns nun zuwenden,
Ist Hacks Voltaire?
Gilt nach Peter Hacks für die Lebenszeit Voltaires das Ablaufschema: Große Zeit des Absolutismus (Louis XIV) – Zwischenzeit (Régence) – Verfall (Louis XV).- schmählicher Untergang (Louis XVI), so für die Lebenszeit Peter Hacks das nämliche: Große Oktoberrevolution – Zwischenzeit (Ulbricht) – Verfall (Honecker) – schmählicher Untergang (Gorbatschow & Co.). Den Niedergang des Absolutismus förderte und betrieb der kleingeistige Feudaladel, den Niedergang der Sowjetunion und der DDR aber betrieben die verbürgerlichten Funktionäre der kommunistischen Parteien. War für Voltaire in seinen Dramen der Kampf gegen Engstirnigkeit und Kleingeistigkeit der rückwärtsgewandten Adelskreise bedeutend, so für Hacks der Kampf gegen die sich dem kapitalistischen Westen anpassenden ‚Entspannungspolitiker’ der kommunistischen Parteien.
Mit dieser Interpretation beleuchtet man eine schmerzhaft eingestandene Parallele, die Hacks im Schicksal Voltaires wiederfindet und ihn dem antiklerikalen, wissenschaftsfreundlichen und antiautoritären Voltaire entfremdet. Auf diesem Wege finden wir eine Positionsbestimmung des Dramatikers Peter Hacks und mit ihr den Grund für die Einschränkung seiner Voltaire-Analyse auf das Louis XIV Schema, das, je weiter die Entstehungszeit eines analysierten Stückes vom Tod Ludwigs XIV. entfernt ist, desto künstlicher wirkt. Zwar stimmt das Schema: ‚Alter König wird von jungen Nachfolgern, oft seinen eigenen Kindern, ermordet’ oft genug, jedoch ist es mehr und mehr biographisch motiviert, denn Voltaire hat im Kampf mit seinem Vater genug auszustehen gehabt, um sich als Dramatiker – nicht ganz ohne Schuldgefühle – die Freiheit zu nehmen, sich dessen Tod vorzustellen. Einer politischen Analyse wäre eine biographisch fundierte an die Seite zu stellen, ohne diese bleibt jene abstrakt, zumindest, was Voltaire betrifft.
Hacks sieht sich, wie Voltaire, als Dramatiker des Übergangs, und zwar eines Übergangs zum Schlechteren, er lebt wie dieser in einer Zeit des Rückschritts und sieht, wie er es von Voltaire behauptet, in der Zeit, aus der er kommt, einen Höhepunkt der Geschichte, von dem aus es immer nur noch bergab geht. Deshalb gilt auch für ihn, er sagt es selbst:
„Über Politik, lohnt nicht mehr zu denken… Es ist schlimm für einen politischen Dramatiker (und gibt es denn einen Dramatiker der nicht, und zwar zuvörderst, ein politischer Dramatiker wäre?), wenn über Politik nicht mehr zu denken lohnt. Heute, Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, wo über Politik ebenfalls nicht mehr zu denken lohnt,, kennen ganz folgerichtig mehr Leute den Namen Calas als den einer einzigen Voltaireschen Bühnenrolle“ (492) – was Hacks ärgerlich darauf zurückführt, dass man den angeblich unpolitischen, den antiklerikalen Voltaire mehr schätzt als den konservativen Umstürzler der Tragödien. Zahlreiche Äußerungen zeigen, wie stark sich Hacks in Voltaire wiederfindet:
„Vom Endzeitdramatiker wird gefordert, dass er die Menschheit aufgibt, ohne die dramatische Gattung und damit sich selbst aufzugeben. Er muss im Untergang Haltung bewahren und trachten, kein anderer Seneca zu werden. Das Unbeschreibliche ist das Unbeschreibliche, aber wer für einen dramatischen Schriftsteller genommen werden will, sollte es doch zu beschreiben versucht haben….Nicht jedes Drama, das von Verfall handelt ist ein Verfallsdrama“.
„Was ist, wenn einer für eine Herrschaftsform einsteht, aber nicht für deren Vertreter? Was, wenn er einer Weltrichtung beistimmt und aber den Mann tadeln muss, der die Richtung bestimmt? (…) Das ist nicht die Art Zwiespalt, aus der Dramatiker entstehen. Falls einer nicht an dem Zwiespalt zerbricht, bildet sich in ihm ein dialektischer Sinn, ein Vermögen zur gerechten Einschätzung der Dinge. Aber es ist eine entsagende Objektivität und eine Dialektik des Verzichts.“(516)
„In der Regel wird ein Klassiker ungefähr mit fünfzig Jahren aus seiner Hauptstadt geworfen…“ (517)
Hacks verschwand Mitte der 70er Jahre in Deutschland in der Versenkung, Opfer der Nichtbeachtung, die nicht nur Honeckers Politik der friedlichen Koexistenz geschuldet war, sondern auch dem sozialdemokratischen Boykott, die in ihm zu Recht den unerbittlichen Gegner witterten.
„Ein Klassiker hat einen König, der meint, die Zukunft beginnt in der Gegenwart. Ein Nachklassiker hat einen toten König. Die Vergangenheit, meint das, will die Zukunft sein“ (518) Auch Hacks war Nachklassiker in diesem Sinn und konservativ zugleich:
„Voltaire war, wie alle anderen Klassiker auch, ein konservativer Umstürzler und ein konservativer Fortschrittler. Mich wundert immer wieder, wie schwer es diese Welthaltung hat, sich Gehör zu verschaffen…. Worauf es doch ankommt, ist, beim Lauf nach dem Glück nicht das Gute, das man schon hat oder hatte, aus dem Korb zu verlieren.“(521)
Peter Hacks, so lautet daraus unsere Schlussfolgerung, interpretiert Voltaire vor dem Hintergrund seiner eigenen, deprimierenden Situation in Zeiten des Niedergangs. Dieses Interpretationsschema trägt ihn ein ganzes Stück, fast bis zu Mahomet, Wo es nicht hinreicht, baut er sich reichlich Brücken, oder ein eigenes Stück: in seiner Tragödie ‚Jona’ sorgt Hacks dafür, dass die Königin Semiramis, die er bei Voltaire etwas mutwillig auf Ludwig XV. reduziert, seinem Ablaufschema voll und ganz entspricht, denn Semiramis meint hier niemand anderen als den wankelmütigen Erich Honecker. Wir erinnern uns an seine Empfehlung: „Die Sémiramis… ist ein empfehlenswertes Stück, und ein überaus anwendbares, falls Sie einen König haben, der nicht recht weiß, was er will“(474).
Hacks zieht für sich selbst aus der unbestechlichen Haltung Voltaires Stärke, dem Verständnis der Tragödien Voltaires dient er, in dem er ihren politisch kämpferischen Charakter unterstreicht, allerdings in so starken Strichen, dass daneben die für Voltaire zentrale antiklerikale Stoßrichtung und die biographisch-psychologische Dimension seiner Dramen sehr verblassen. Diese starken Striche zeichnen am Ende weniger das Porträt des großen Franzosen, als jenes des großen sozialistischen Klassikers Peter Hacks. Möglich, dass die von ihm beschworene Parallele Hacks=Voltaire 11 Jahre nach seinem Tod zu ähnlichen Ereignissen führen wird wie bei Voltaire:, 11 Jahre nach dessen Ableben schrieb man bekanntlich das Jahr 1789. Hoffen wir also auf Hacks, denn: „Dichter haben ihre Nasen einmal in der Zukunft stecken“.
______________________________________
* Rainer Neuhaus ist Sozialwissenschaftler und gibt für die Voltaire-Stiftung die Internetseiten zu Voltaire www.correspondance-voltaire.de heraus
** eine psychoanalytische Analyse des Ödipus gibt José-Michel Moureaux, L`Oedipe de Voltaire, introduction à une psycholecture, Paris: Lettres modernes, 1973
*** René Pomeau, Voltaire en son temps, Paris: Fayard, 1985, 1. Bd.